
Alyssa Brugman: Solo
Schutz, Geborgenheit, Liebe – diese Werte hat die junge Mackenzie nie kennengelernt. Nicht in der Familie und auch sonst nirgends.
München: dtv (Reihe Hanser) 2009
Schutz, Geborgenheit, Liebe – diese Werte hat die junge Mackenzie nie kennengelernt. Nicht in der Familie und auch sonst nirgends. Für sie ist der Titel des neuen Jugendromans von Alyssa Brugman Lebensprogramm: „Solo“.
Mackenzie ist allein. Ihr Vater ist nach einem Ereignis, über das sie nicht sprechen will, verschwunden; die Mutter, ein Junkie, hat das halbwüchsige Mädchen von einem Tag auf den anderen ihrem Schicksal überlassen. Die Erwachsenen, an die sie sich hilfesuchend wendet, wimmeln sie ab. Anfangs versucht der Teenager noch, den Schein zu wahren, geht zur Schule, sucht sich immer wieder wechselnde Schlafplätze. Doch die psychische Belastung sucht sich ihr Ventil: Mackenzie zündet eine Garage an, fällt durch Gewaltausbrüche auf und landet schließlich in einem Camp irgendwo im australischen Outback. Zusammen mit anderen „Jugendlichen mit Potenzial“, wie die schwer geschädigten jungen Menschen von den Betreuern genannt werden.
Eine der dort angebotenen Therapiemaßnahmen ist das “Solo“ – vierundzwanzig Stunden allein im Busch. Mackenzie lässt sich darauf ein und stellt sich ihren Dämonen, die sie in einem für sie sehr realen Sinn verfolgen. Allein in der Wildnis begibt sie sich auf Spurensuche, erzählt in Rückblenden Geschichten aus ihrem Leben, Momentaufnamen und Schlüsselsituationen: Diese ergeben keine chronologische Biographie, sondern das Puzzle einer Realität, die über weite Strecken nicht mit dem übereinstimmt, was wirklich passiert ist: Eine selbst zusammengebastelte Wirklichkeit, die viel schöner und in jedem Fall erträglicher ist als die Wahrheit.
„Das Problem ist, zu entziffern, was wirklich ist. Ich habe es schon getan – mit Tagträumen, ausgedachten Geschichten und Lügen, wie immer man es sehen will. Ich weiß nicht, wie viel ich mir ausgedacht habe. Lauter Versuche, die Knoten zu lösen“.
Da wird eine Vergewaltigung nicht als solche rückerinnert, sondern als eine Nacht, in der sie der Jugendliche nicht missbraucht, sondern ihr bis fünf Uhr morgens aus seinem Leben erzählt. Da wird der Vater als netter Mann, der in einer Drogerie arbeitet, konstruiert. Wie er wirklich war, was passiert ist, wieso ihr Halbbruder Scott gestorben ist, das kann sich Mackenzie erst am Ende ihres Solos eingestehen.
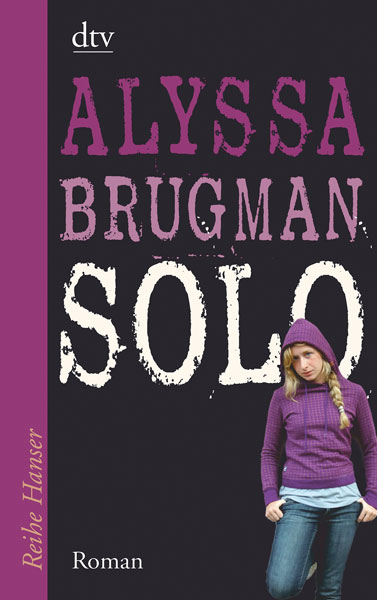
Das Spannende an diesem Buch ist, Mackenzies Geschichten zu verfolgen ohne zu wissen, ob sie wahr sind. Die Ich-Erzählerin führt nicht nur sich selbst, sondern auch den Lesenden in die Irre. Legt Spuren, die auf die Wahrheit verweisen genauso wie solche, die ihre andere, erdachte Wirklichkeit glaubhaft machen. Mackenzie ist schlau, ihre Strategien zur Neuschreibung der Geschichte sind nicht so ohne weiteres zu durchschauen.
Das Mädchen hat schon soviel mit Therapeuten und Betreuern zu tun gehabt, dass psychologische Fachtermini wie selbstverständlich zu ihrem aktiven Wortschatz gehören, ihre Fähigkeit zur Selbstanalyse ist hoch. Wenn die Betreuerin kombiniert, dass Mackenzies negative Haltung sie daran hindert, stabile Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, korrigiert diese: „Sie irrt sich. Was mir fehlt, ist die Motivation.“
Die junge australische Autorin hat einen Charakter und ein Leben im sozialen Abseits nachgezeichnet, ohne in billigen Sozialvoyeurismus zu verfallen. Keine Elendsbeschreibungen, keine ausufernden Darstellungen von Gewalt. Mackenzies existentielle Vernachlässigung wird zwar explizit vermittelt, aber nicht ausgeschlachtet. Ihr Schicksal macht betroffen, aber die Autorin legt es nicht darauf an, Mitleid mit der Figur zu erzeugen. Man empfindet beim Lesen eher Bewunderung dafür, wie dieses Mädchen mit ihrer Kindheit und den extremen Ereignissen, denen sie schuldlos ausgesetzt war, umgeht. Wie sie sich bei allen psychischen Beschädigungen, Panikattaken und Phobien Würde und Stärke bewahrt hat und den Willen, zu überleben. Literarische Sympathierträgerinnen müssen nicht zwangsläufig nett sein.

