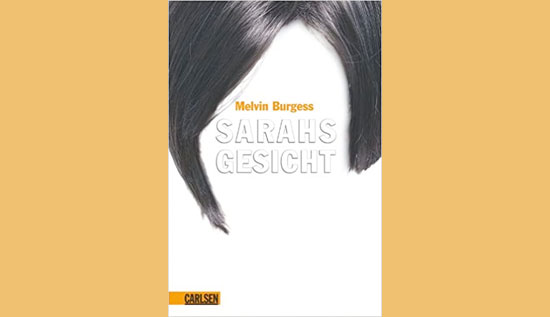
Melvin Burgess: Sarahs Gesicht
„Les Yeux sans visage“ – „Eyes without a Face“ – hieß ein französischer Independentfilm Anfang der 60er Jahre, der den britischen Autor Melvin Burgess zu seinem neuen Jugendroman inspirierte.
Hamburg: Carlsen 2007
„Les Yeux sans visage“ – „Eyes without a Face“ – hieß ein französischer Independentfilm Anfang der 60er Jahre, der den britischen Autor Melvin Burgess zu seinem neuen Jugendroman inspirierte: „Sarahs Gesicht“. Ein Thriller, ja, das vor allem. Aber auch das Psychogramm einer zutiefst gestörten Jugendlichen, die den Bezug zu sich selbst sosehr verloren hat, dass sie nur im Spiel mit imaginierten Identitäten und dem Tragen von Masken existieren kann. Und eine gruselige Auseinandersetzung mit dem Schönheitswahn einer „Nip and Tuck“ – Gesellschaft, die sich ihr Äußeres wie Kleider zusammenflicken lässt.
Als Sarah dem alternden Popstar Jonathon Heat begegnet, dessen Gesicht nach einer Unzahl abstruser Operationen völlig verwüstet ist, zieht sich das Netz von Selbstentfremdung, übersteigerter Sehnsucht nach Ruhm und Außergewöhnlichkeit, Wahnvorstellungen und Lügen immer enger um die Siebzehnjährige zusammen. Abgeschottet von allem, was den Namen „Realität“ verdient, lebt sie in unvorstellbarem Luxus auf dem Landgut Heats, der ihr alles verspricht, was sie sich wünscht: den Durchbruch als Sängerin, eine neues Aussehen, ein neues Leben, ein neues Selbst. Ihr Freund Mark, der mit allen Mitteln versucht, das unvorstellbare Ende abzuwenden, scheitert. Die Operation, die Sarah ihr Gesicht und damit ihre Identität nehmen wird, findet mit ihrer Einwilligung statt. So erreicht sie, Akteurin und Opfer zugleich, das was sie immer wollte: „Es geht darum, mehr zu sein, als du bist“.
Das Buch ist voll mit Anspielungen auf die Auswüchse einer krankhaft auf Äußerlichkeiten fixierten Gesellschaft, die Mädchen und Frauen in die Operationssäle treibt. Selbstverletzungen und Magersucht als sichtbare Spitzen eines Eisberges von gestörten Beziehungen zu sich selbst und der Unfähigkeit, individuelle Durchschnittlichkeit oder Abweichungen von aufoktroyierten Idealen als positive eigene Identiät annehmen zu können.
Burgess, der spätestens seit seiner Romanfassung des Films „Billy Elliot - I will dance“ auch über die Grenzen der Jugendbuchszene hinaus bekannt ist, kalkuliert seine Bücher sehr bewusst in Richtung Provokation. War es im viel diskutierten „Doing it“ 2004 die plakative Schilderung jugendlicher Sexualität, so ist es in „Sarahs Gesicht“ das Spiel mit der Horrorvision einer totalen Gesichtstransplantation. Da wird einem jungen Mädchen das Gesicht abgezogen, damit eine Berühmtheit es sich überstülpen kann.
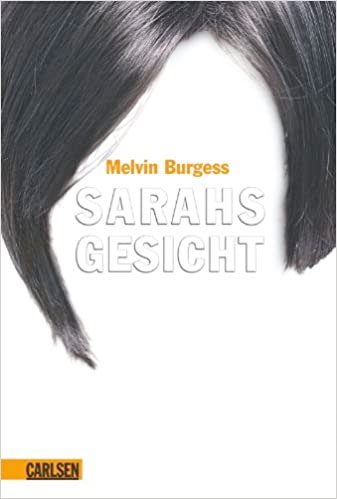
Provokation als Kalkül kann schief gehen. Bei Burgess gelingt sie, in „Sarahs Gesicht“ besser als in „Doing it“, weil er dieses Mal sprachlich weitgehend von übersteigerten Effekten absieht. Zwar arbeitet er mit den Versatzstücken klassischen Horrors, Geistererscheinungen inklusive, hält sich aber in der Schilderung unappetitlicher Details zurück. Da spritzt in jeder Folge von „Grey´s Anatomy“ oder eben „Nip and Tuck“, die unter jugendlichen SeherInnen zu den Spitzenreitern zählen, mehr Blut. Bei Burgess findet die Operation hinter verschlossenen Türen statt. Was den suspense erhöht - bekanntlich fürchtet man sich viel mehr vor dem, was man nicht sieht.
Der Autor führt exemplarisch vor, wie sich Spannung und die Faszination des Grauens in einem Text erzeugen lassen. Anziehung durch Abstoßung. Man liest und liest und hört nicht mehr auf, so wie man einen Film nicht abschalten kann, obwohl man ahnt, dass er einem schlechte Träume bescheren wird. Und nimmt sich vor, den alten französischen Film aus der Videothek auszuborgen.

