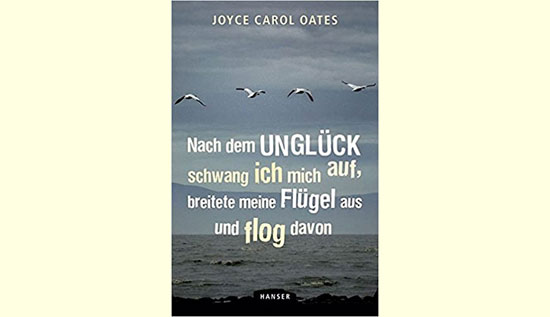
Joyce Carol Oates: Nach dem Unglück schwang ich mich auf, breitete meine Flügel aus und flog davon
„Nach dem Unfall würde niemand von meinen Verletzungen erfahren, das stand für mich fest. Und ich würde mich nie mehr verletzen lassen. Auch das stand für mich fest.“
München: Hanser 2008
„Nach dem Unglück schwang ich mich auf, breitete meine Flügel aus und flog davon“. Schon im Titel hat Joyce Carol Oates Anfang und Endpunkt ihres neuen Jugendromans fixiert.
Der Anfang: ein Autounfall auf einer Brücke, bei dem Jennas Mutter stirbt, sie selbst nur knapp überlebt. Das Ende: die Neuorientierung in ihrem Leben nach der Zäsur. Dazwischen liegt eine von inneren und äußeren Schmerzen geprägte Zeit.
„Nach dem Unfall würde niemand von meinen Verletzungen erfahren, das stand für mich fest. Und ich würde mich nie mehr verletzen lassen. Auch das stand für mich fest.“
Jenna verweigert sich ihrem neuen Leben, will dieses „Jetzt“ prinzipiell nicht. Kann weder die liebevolle Zuwendung ihrer Tante, in deren Familie sie nun lebt, annehmen, noch sich in der neuen Schule integrieren. Der einzige Mensch, bei dem sie Emotionen - uneingestanden aber doch - zulässt, ist der aus der Ferne adorierte Crow: ein Schüler aus der Abschlussklasse, der unter der Oberfläche des „Bad Boy“ emphatische Sensibilität und Verantwortungs-bewusstsein besitzt. Und dann wird Trina ihre Freundin. Das ältere Mädchen spiegelt Jennas Situation unter anderen Vorzeichen: Orientierungslos, wenn auch aufgrund von Wohlstandsverwahrlosung und nicht, weil ihr wie Jenna jeder Orientierungspunkt schlagartig abhanden gekommen ist. In ich-bezogener Oberflächlichkeit zu gar keiner Freundschaft fähig, so wie Jenna in ihrer emotionalen Erstarrung keine Beziehung zulassen kann, in der sie wirklich wahrgenommen wird. Mit Trina zieht sich der Kreis der im Krankenhaus begonnenen Medikamentensucht enger, verbindet sich mit Alkohol, Lügen und Regelbrüchen aller Art, bis es schließlich zur Eskalation kommt. Erst danach kann Jenna sich von Crow über eine Brücke führen lassen, sich erinnern, mit ihrem traumatischen Erlebnis besser zurecht kommen. Wieder neu anfangen.
Schon der Beginn des Romans ist stilistisch fulminant. Mit kraftvollen Bildern zieht Oates den Leser in das Innenleben Jennas hinein, die im Krankenhaus unter starken schmerzlindernden Mitteln dahindämmert, bis der Schonraum der Sedierung immer mehr aufgebrochen wird. „Im Blauen war mein Versteck gewesen, jetzt, in dieser rohen Welt, gab es keinen Ort mehr, wo ich mich verstecken konnte.“ Im Blauen konnte sie fliegen, in der wirklichen Welt kann sie zunächst nicht einmal gehen.

Der Text emotionalisiert. Thema und sprachliche Umsetzung, Handlungselemente und Spannungshöhepunkte zielen direkt auf den Bauch des Lesers. Nicht auf seinen Kopf. Der, speziell wenn er einem Kritiker gehört, punktuelle Einwände finden könnte. Wenn Crow wie Deus-ex-machina plötzlich vor Jenna auftaucht, um ihr zu helfen. Und von Anfang an klar ist, dass es kein Happy End zwischen den beiden geben wird. Wenn Trina oder die Figur des Vaters – zu dem Jenna den Kontakt verweigert - keinen Millimeter aus den ihnen zugeschriebenen erzählerischen Funktionen heraustreten.
Einem jugendlichen Leser, in diesem Fall vermutlich eher einer Leserin, wird das herzlich egal sein. Poesie, Metaphorik, emotionale Zugänge sollte man an einem Buch mögen – und dann entwickelt diese Geschichte einen geradezu magnetischen Sog.
Denn sie ist einfach außergewöhnlich gut geschrieben. Ein Glücksfall für die Jugendliteratur, dass sich die renommierte amerikanische Vielschreiberin nun immer wieder auch einem jungen Publikum widmet. Hoffentlich noch oft.

