
Ron Koertge: Monsterwochen
„Krieg ich Ermäßigung? Wegen der Monster-Woche“ fragt der Spastiker Ben an der Kinokasse und sieht sich „Frankensteins Braut“ an.
Hamburg: Carlsen 2004 | 143 S.
„Krieg ich Ermäßigung? Wegen der Monster-Woche“ fragt der Spastiker Ben an der Kinokasse und sieht sich „Frankensteins Braut“ an. In dieser Vorstellung trifft er zufällig auf eine zugekiffte Mitschülerin, ein Mädchen, das seiner Einschätzung nach immer Stress bedeutet und das dann auf der Heimfahrt auch prompt aus dem Auto seiner Großmutter kotzt. Dass er sich in sie verliebt, war nicht geplant, und dass sie ihn, den Krüppel, auch tatsächlich an sich heranlässt, ja schließlich sogar die Initiative ergreift, nicht vorherzusehen. Viel haben sie ja nicht gemeinsam: Er, der immer adrett gekleidete, gut erzogene und behütete Musterknabe, sie, die schnoddrig-sympathische Drogensüchtige mit der blassen Schönheit wie aus einem Ozzy Osbourne Video. Und doch werden sie ein Paar, zugegeben – ein ziemlich schräges.
„Monsterwochen“, nach „Der Tag X “ die zweite deutschsprachige Übersetzung des kalifornischen Autors Ron Koertge, führt zwei Außenseiter zusammen und erzählt eine Art „Erweckungsgeschichte“. Durch Colleen bricht Ben aus seiner selbstinszenierten Behindertenisolation aus und tut Dinge, die der Film-Freak im Ghetto seines bisherigen Lebens bei der betuchten Großmutter nur von der Leinwand kannte: in einen abartigen Rave-Club tanzen gehen, einen Joint rauchen, küssen, mit einer Frau schlafen. Seine Berufung finden, die voraussichtlich auch einmal sein Beruf werden wird – selbst Filme zu machen. Mit Hilfe einer Nachbarin, die unkonventionell und unaufdringlich Bens Entwicklungsprozess fördert, dreht er seinen ersten eigenen Dokumentarfilm: „Highschool Confidential“ zeigt Interviews mit seinen Mitschülern – Short Cuts von amerikanischen Jugendlichen. Farbige, Weiße, Asiatinnen, Alkoholikerinnen, Dealer, Mädchen, die schon als Kinder Kinder gekriegt haben. Schön ist anders.
Das alles riecht eigentlich meilenweit nach problemorientierter Literatur, nach Überfrachtung und Konstruiertheit, nach moralinsaurer Pädagogik. Nichts davon trifft für die „Monsterwochen“ zu. Klar geht´s um Probleme, wie nicht, wenn der eine Protagonist an CP, an Zerebralparese, leidet und die andere dauernd irgendwelche illegalen Substanzen zu sich nimmt. Doch durch den unsentimentalen Zugang und den staubtrockenen Humor verlieren sie an erzählerischem Gewicht – aber nicht ihren Tiefgang. Beschönigt wird auch nichts.
Nicht Bens spastische Lähmung, nicht Colleens Hang zu allem, was high macht, der sie diretissima ins Krankenhaus, in den Entzug und in dessen Scheitern führt.
Denn ihre Beziehung hat von Anfang an ein Ablaufdatum. Für die Dauer des Buches haben sie einander gebraucht – er sie, um, wie ein Mitschüler es ausdrückt, von den Toten wiederaufzuerstehen wie der Schul-Lazarus. Sie ihn, um zumindest den Versuch zu starten, aus ihrer orientierungslosen inneren Einsamkeit herauszukommen.
Doch am Ende des Buches wird klar, dass ihre Wege wieder auseinandergehen. Er hat den Absprung in ein neues Leben geschafft, sie nicht.
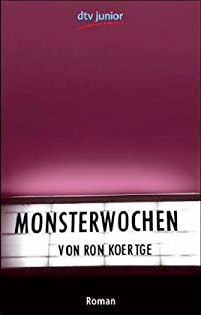
„Blödsinn. Ich bring´s dir bei.“
„Nein, ich meine, mein eines Bein ist kürzer als das andere.“
„Im Aorta tanzen alle so. Da passt du gut hin.“
Ganz egal, was der Ich-Erzähler in inneren Monologen gerade reflektiert, was er schildert, welche Gespräche wie im O-Ton eines Kinofilmes wiedergegeben werden, der Text wird getragen von gnadenlos bissiger Selbstironie. Alles sehr cool, alles sehr amerikanisch, alles sehr witzig. Problemorientierte Jugendliteratur kann so leicht sein.

